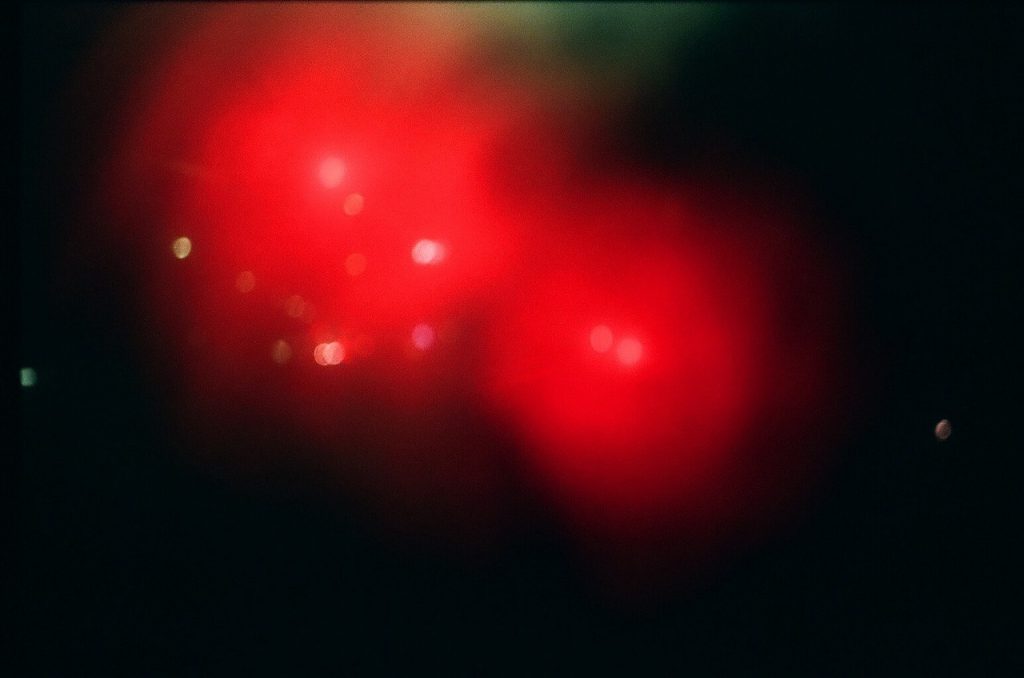Olga Hohmann
Fotos von Lea Hopp
Neulich saß ich im Bus Nummer M29, auf dem Weg von Kreuzberg nach Charlottenburg. An der Kreuzung zur Friedrichstraße stieg ein Soldat ein. Ich sah ihn zuerst von meinem Platz am Fenster der oberen Etage aus einsteigen und war spontan irritiert von der Uniform: Obwohl es sich offensichtlich nicht um die der Bundeswehr handelte, kam sie mir bekannt vor. Der Mann kam die Treppenstufen herauf und setzte sich in die Sitzreihe neben mir. Jetzt konnte ich sehen, dass auf seinem rechten Ärmel die schwarz-rot-goldene Flagge aufgenäht war – trotzdem konnte ich seine Montur nicht zuordnen: Es war keine Bundeswehruniform.
Ich schaute ihn noch eine Weile lang gedankenverloren an (die Wahrnehmung nur zur Hälfte auf meine Außenwelt gerichtet – denn eigentlich war ich im Kopf mit meinem bevorstehenden Zahnarzttermin beschäftigt) da wurde mir plötzlich klar, worum es sich bei der Erscheinung handelte: Der neben mir sitzende Mann war einer der „Schauspieler“, deren Aufgabe es ist, den ganzen Tag als „Soldat der Nationalen Volksarmee der DDR“ am ehemaligen Grenzübergang „Checkpoint Charlie“ zu stehen und sich dort von Touristen fotografieren zu lassen. Der unterforderte Schauspieler fuhr in seiner Grenzuniform von der Arbeit nach Hause.
Noch ein halbes Jahrhundert vor dem Zeitabschnitt, auf die die Aufmachung des falschen Soldaten neben mir anspielte, beschrieb Walter Benjamin in seiner „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“ wie er im Vorschulalter immer wieder die unterste Schublade der Kommode im Schlafzimmer seiner Eltern öffnen musste. Gerade hoch genug um dieses niedrigste Schrankfach mit den Händen zu erreichen, war er magisch angezogen von der sich darin befindenden Sockenabteilung. Mehrmals am Tag entriegelte er das Kommodenfach, schob seine Hände hinein und suchte mit den Fingern nach den kleinen Sockenknäueln. Hatte er sie gefunden, schob er seine Finger in die Strumpfpäckchen, verweilte so einen Moment lang und zog sie dann, halb erregt, halb befriedigt, wieder heraus. Die Finger in die in sich selbst verpackten Knäuel einzuführen, hatte etwas Verheißungsvolles – die Pakete wirkten, als wäre im Inneren ihrer Rundung etwas versteckt. In Wirklichkeit waren sie aber nur „mit sich selbst“, „in sich selbst“ verknotet.
Ich lese die kurze Benjaminsche Strumpf-Anekdote als einen Kommentar auf frühkindliches Begehren. Innerhalb des Sockenknäuels ist die Suche nach dem „Inhalt“ vergeblich: Das Begehrte Innere bleibt unerreichbar und das Begehren genau deshalb bestehen. Die scheinbare Vergeblichkeit wird zur Notwendigkeit – eine Erlösung ist, zum Glück, unmöglich. Hinter jeder Schicht Geschenkpapier befindet sich eine weitere und damit verlängert sich die Vorfreude ins Unendliche.
Auch die Stadt Berlin ist lustvoll in sich selbst verstrickt – sie wird sich und bleibt sich, mit fortschreitender Zeit, selbst fremd, ist nicht-identisch mit sich selbst. Sie ist ein ewiges Versprechen, das sich nur deshalb einlöst, weil einem sich ihr Kern nie offenbart. Anders als, zum Beispiel, amerikanische Städte ist ihre architektonische Zerstreutheit aber nicht programmatisch: Während man im Bus Nummer M29 sitzt, antizipiert man zu jeder Zeit, sich dem „Zentrum“ zu nähern – und entfernt sich dabei doch gerade von einem anderen.
Anstelle eines Berliner Stadtkerns, eines Nukleus, befinden sich Überlagerungen, Zwischenlagerungen und Ablagerungen. Diese bestehen, zum Beispiel, aus sich überschneidenden Zeitlichkeiten. Auch die historische und politische „Aufschichtung“ offenbart sich einem besonders dann, wenn man einen der Plätze an der Frontscheibe des M29ers ergattert (die häufig von Kindern besetzt sind). Die Buslinie führt vom Neuköllner Hermannplatz durch die Kreuzberger Oranienstraße vom Heinrichplatz bis zur Rudi Dutschke Straße wird – wo sich, am Checkpoint Charlie, der Soldat neben mich setzte – , schwankt vorbei an der Topografie des Terrors und anschließend den gesamten Kudamm hinunter, bis zu einer Station namens „Roseneck“, die (passend zum Namen) am Grunewald liegt – und von dort dann wieder zurück.
Mit dieser Route beschreibt der „M29er“ die öknonomische und kulturelle Diversität des ehemaligen Westberlins akkurat – besonders eindrücklich in ihrer Eigenschaft, sich häufig nur wenige Meter von der Grenze zum Osten zu befinden, diese Grenze aber nie zu überschreiten. In den dabei auf seiner Route durchquerten sozialen und ästhetischen (archäologischen) „Schichten“, die auf den ersten Blick wie Gegensätze anmuten, ist man aber auch vor allem mit Überkreuzungen, Überschreibungen und Zwischenkategorien konfrontiert: Mit entschiedener Schmuddeligkeit am Heinrichplatz (wo sich nostalgische Touristen gegenseitig vor dem geschlossenen SO36 fotografieren) und Guns‘n Roses Rockern am „Roseneck“. Im M29er treffen sich zufällig Journalistinnen, die zu, Axel-Springer-Verlag oder der taz gehören (beide liegen an derselben Straßenecke) – und die sich trotzdem freundlich zur Begrüßung die Hand schütteln – und da, wo man früher die Grenze zum Osten überquert hätte, steigen Schulklassen mit Starbucksbechern in der Hand ein. Die scheinbaren Gegensätze und die durch sie beschriebenen, Achsen haben sich längst verschoben: Vergangenheiten, Gegenwarten und mögliche Zukünfte sind, wie Benjamin es in seinem Passagenwerk als signifikantes Merkmal für die „Großstadt“ charakterisiert, immer gleichermaßen präsent – in jedem Zeitfragment und jedem Kulturfragment ist auch immer sein Gegenteil gespeichert, indem es, als abwesende Präsenz, aufscheint oder sich als bereits erschreckend Anwesend offenbart.
Meine erste Erinnerung an den M29er ist Folgende: Auf einem Ausflug mit meiner Kindergartengruppe in den Zoo ergatterte ich einen der heiß begehrten Plätze an der Frontscheibe der oberen Etage. Vergnügt über meinen Erfolg, den „besten Platz“ bekommen zu haben, legte ich meine kurzen Beine auf der gelben Metallstange ab, die vor dem Fenster angebracht war – eine Geste der Entspannung und der Besitzmarkierung. Plötzlich ertönte eine laute und unfreundliche Stimme aus dem Nichts – „Füße runter von der Stoßstange“, sagte der „Große Andere“. Ich zuckte automatisch zusammen. Jahrelang rätselte ich, wer damals mit mir gesprochen hatte – und noch heute traue ich mich selten, meine Füße auf der gelben Metallstange abzustellen, obwohl es die Qualität der Fahrt auf dem besten Platz stark erhöht. Ich suche dann regelmäßig nach der Kamera, die zum Fahrerhäuschen führt, habe sie aber bisher nie gefunden.
Auch in meiner eigenen Berliner Kindheit waren also Strümpfe präsent – jene die, verbotenerweise, auf der Stoßstange des M29ers platziert waren.
Für Menschen, die Berlin nicht kennen, ist eine Fahrt mit dem Bus Nummer M29 leider müßig: Die Stadt erzählt ihre Geschichte nicht von allein, sie braucht VermittlerInnen um sich in ihrer Komplexität, in ihrer „Aufschichtung“ zu offenbaren – eine Eigenschaft, die ich als charakteristisch für ganz Berlin ausmachen würde und die mich mit einem gewissen Stolz der Eingeweihten erfüllt.
Weil ich ihn so lange sinnierend angestarrt hatte, wurde der aus der Zeit gefallene Grenzoldat auf mich aufmerksam – er schaute zurück und lächelte mich (sich seiner eigenen Deplatziertheit bewusst) halb verschämt, halb selbstironisch an. Wir fuhren noch einige Stationen nebeneinander her und ich genoss den Moment der ineinander verschobenen historischen Ebenen, der auch meine zeitliche Realität für einen Moment in einen Zustand der Austauschbarkeit versetzte. Genau wie der Soldat fühlte ich mich plötzlich deplatziert – ich versuchte mir vorzustellen, dass nicht er, sondern ich in der falschen Zeit gelandet wäre und war mir gleichzeitig, ebenfalls leicht selbstironisch, der naiven Romantik dieses Gedankenspieles bewusst.
So vor mich hinstarrend, fasste ich auf einmal in etwas Weiches, das sich an der Unterseite meines Sitzes befand: ein Kaugummi (am den Sitz geklebt wie die historischen Epochen an der Stadt).
Nachdem ich den kurzen Moment des Ekels über den Kontakt mit fremdem Speichel überwunden hatte, spürte ich plötzlich eine ähnlich lustvolle Erregung, wie vor über hundert Jahren das Kleinkind Walter (Benjamin), wenn es seine Hand heimlich in die Strumpfpäckchen ausstreckte, und und so ließ ich meinen Finger noch einen kurzen Moment in diesem (in der „aktuellen Situation“ besonders stigmatisierten) hoch ansteckenden klebrigen Material verweilen.
Ein befreundeter Archäologe sagte neulich zu mir: „Schichten gibt es gar nicht, sie werden konstruiert von denen, die sie ausgraben“. Wahrscheinlich konstruiere ich also, anhand einer Fahrt mit dem M29er, meine eigene „Berliner Kindheit“. Die gesamte Essaysammlung werde ich im kommenden Herbst, im Rahmen des Projektes „Modell Berlin“ als Lesung in der St. Matthäus Kirche am Potsdamer Platz präsentieren. Am besten zu erreichen ist der Veranstaltungsort mit der Buslinie „M29“ – die Station heißt „Potsdamer Brücke“.
Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Lea Hopp entstehen, von der auch die Fotoserie ist, die diesen Text begleitet. Sieben Jahr lang wohnten wir zusammen direkt gegenüber der Station „Adalbertsraße/Oranienstraße“.